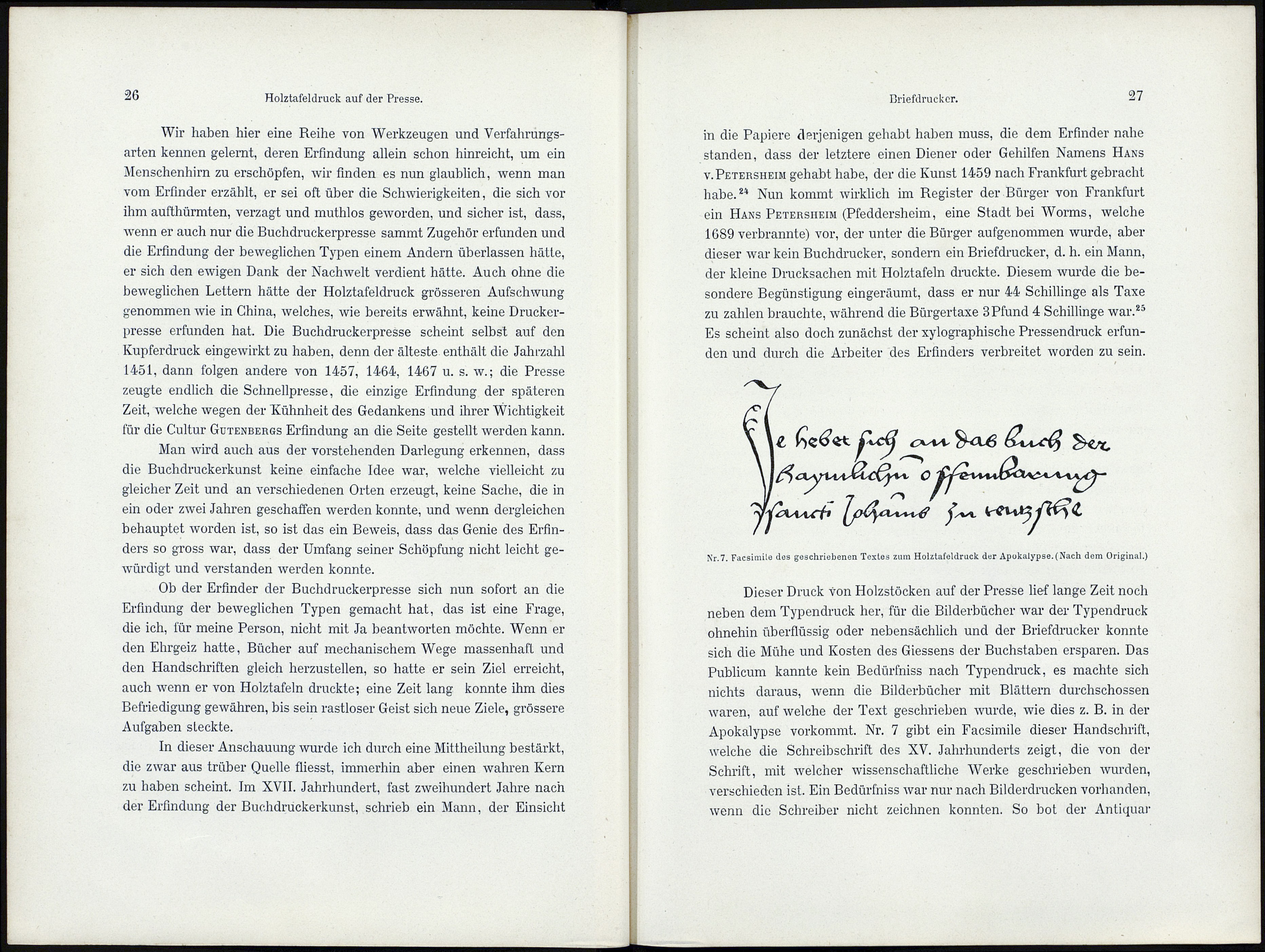24-
Die Druckfarbe.
füllte denselben 3/4 voll, stellte ihn auf einen eisernen Dreifuss und machte
unter demselben mit ausgetrocknetem Holze anfangs starkes Feuer, bis
das Leinöl ordentlich zu kochen anfing; war das Leinöl recht imSieden,
so nahm man einige Stücke Semmeln oder Roggenbrod und hielt sie an
einem hölzernen Spiesse ins Oel, bis sie braun geworden waren und sich
voll Oel gesogen hatten (davon sollte das Oel dunkler werden und beim
Drucken die Farbe leicht trocknen); man nannte dies Abkreischen
oder Abkrösehen. Man bediente sich auch statt desselben der Silber¬
glätte und Minie, oder des gepulverten Glases, oder Steinöls oder des
kostbaren Balsam copaiva. Hierauf wurde der Kessel mit einem inneren
und äusseren Deckel verschlossen, eine Querstange durch den Griff
des äusseren Deckels und durch die beiden Henkel gesteckt und diese
Stange so verkeilt, dass sie eine gerade Richtung erhielt, damit, wenn
das Leinöl zu Firniss gesotten war, der Kessel von zwei Personen vom
Feuer ab und in ein in der Nähe gegrabenes Loch getragen werden
konnte. Hierauf wurde der Deckel mit Lehm gut verschmiert, damit
kein Oel während des Kochens herausdringen und an der Luft Feuer
fangen konnte. War alles Wasser verdunstet, was man am Gerüche
erkennen konnte, so brachte man den Kessel in das Loch, welches
vorher mit angebranntem Holz ausgewärmt war und liess ihn eine
Weile stehen, bis das Kochen nachgelassen hatte, dann öffnete man
vorsichtig den Deckel und versuchte den Firniss, ob er Faden ziehe.21
Es ist wohl fraglich, ob man im XV. Jahrhundert mit allen diesen Ein-
zelnheiten so bekannt war, aber Lanzi berichtet von einem alten Manu-
scripte von 1437, in welchem gesagt wird, dass die neue Methode in
Oel zu malen, wie sie von den Deutschen gebraucht wurde, mit dem
Kochen von Leinöl begann.22 War der Firniss bereitet, so wurde er
mit den übrigen Ingredienzen, die wir aus der Rechnung der Ripoli-
Druckerei kennen, gemischt, wobei anzunehmen ist, dass das Pech
verbrannt wurde, um den nöthigen Russ zu erzeugen, Schellack und
flüssiger Firniss sollten der Farbe eine glänzende Oberfläche geben.
Gutenberg, dessen Farbe schwarz, aber nicht glänzend ist, scheint
Schellack nicht verwendet zu haben. Uebrigens nimmt sich die
Schwärze auf Papier besser aus, als auf Pergament, welches überhaupt
nicht gut zu drucken war, durch das nothwendige Feuchten seinen
Die Druckerballen.
25
Glanz verlor und rauh wurde; der Glanz erhielt sich nur auf einer Seite,
wenn blos die Rückseite gefeuchtet wurde, welche rauh blieb; wurde
das Pergament auf beiden Seiten gefeuchtet, so waren beide Seiten
rauh, war das Pergament zu feucht, wurde die Farbe blass und ersäuft.
Ob der Erfinder der Buchdruckerkunst sich seinen Firniss selbst ge¬
kocht hat, wissen wir nicht, wahrscheinlich kaufte er ihn gesotten und
derselbe war wohl damals noch nicht so gefälscht, wie später, wo
durch diese Fälschungen die Drucker genöthiget wurden, sich ihn selbst
zu kochen; jedenfalls war er aber theuer. Bezüglich der rothen Farbe
kann ich sagen, dass ich einen Unterschied zwischen den geschriebenen
Zeilen und den gedruckten nicht gefunden habe, auch die geschriebe¬
nen Zeilen scheinen mit Oelfarbe oder zähem Zinnober geschrieben.
Die fertige Farbe wurde zuerst auf dem Farbentische und dann
zwischen zwei Ballen gerieben, welche auch zum Aufträgen der Farbe
auf die Schrift dienten. Wir sehen auf allen Abbildungen der Presse
den Gehilfen diese Ballen handhaben, entweder die Farbe zwischen
ihnen zerreibend oder die Farbe auf die Schrift drückend. Auch das
war keine leichte Beschäftigung. Eine gleichmässige Vertheilung der
Farbe auf die Schrift erforderte zum mindesten eine gute Uebung. Die
Ballen sind erst im XIX. Jahrhundert durch die Farbewalzen verdrängt
worden, ihre Wichtigkeit für den Buchdruck geht daraus hervor, dass
sie in das Buchdruckerwappen gesetzt wurden. Zu ihnen wurden Ham¬
melfelle oder Hundsfelle, wie sie die Weissgerber zuzurichten pflegten,
noch mit Fischthran getränkt und halb gewalkt, genommen ; aus diesen
wurden die Ballenleder zirkelrund geschnitten, und vor dem Gebrauch,
je nachdem sie dick oder dünn waren, eine halbe Stunde oder kürzer
eingeweicht. Dicke eigneten sich besser für grosse Schrift. Hierauf rieb
man sie noch mit den Händen, um sie geschmeidiger zu machen,
nagelte sie auf das Ballenholz bis auf eine Oeffhung, durch welche man
die gezausten Ballenhaare einstopfte nicht zu fest und nicht zu leicht,
und nagelte dann die Oeffnuiig zu. Der Drucker musste die Ballen
wöchentlich wenigstens zweimal abschlagen, die Haare herausnehmen,
sie frisch zausen, trocknen und wieder in die Ballen stopfen.23 Es ist
möglich, dass die Ballen schon zum Reiberdruck dienten, für den Buch¬
druck mussten sie aber sicherlich einer Modification unterworfen werden.